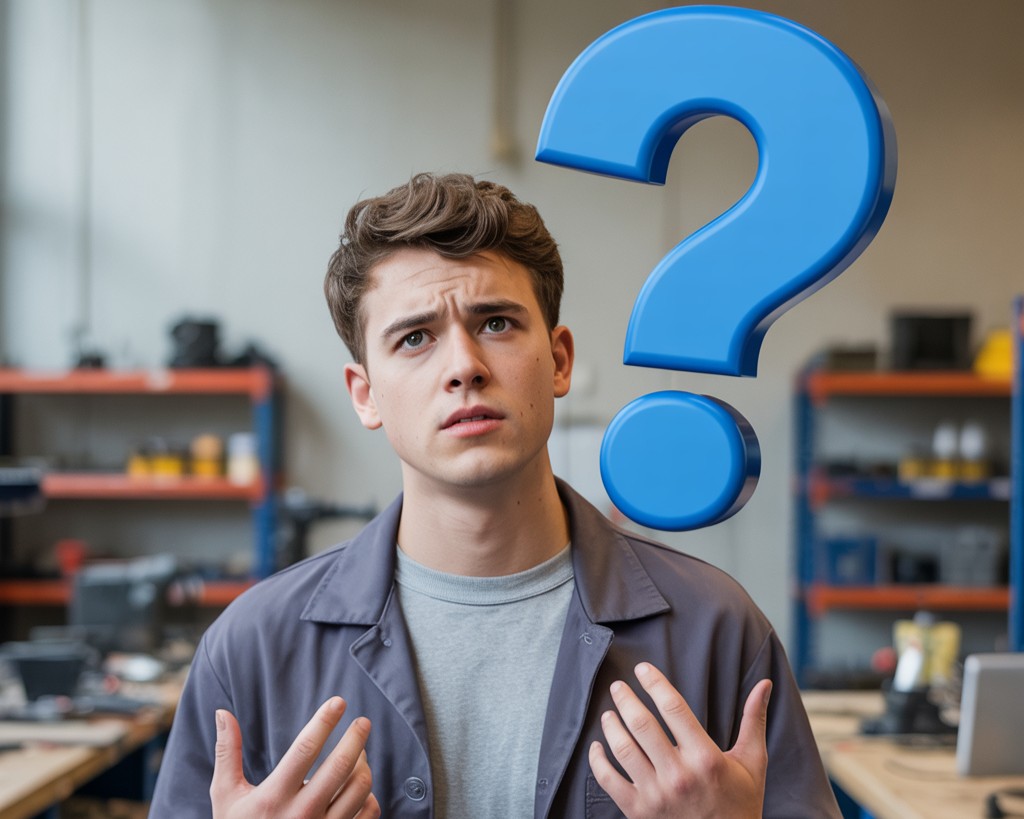
7 AZUBI-TIPPS Die solltest du auf jeden Fall wissen!
Frage lieber einmal mehr nach, als still vor dich hinzugrübeln
Gerade am Anfang erwartet niemand, dass du alles weißt. Wenn du etwas nicht verstanden hast, scheue dich nicht nochmal nachzufragen. Es zeigt dein Interesse und du ersparst dir Fehler.
Sprich mit Azubis aus anderen Abteilungen oder Lehrjahren
Sie wissen über die Abläufe im Betrieb schon gut Bescheid und oft bekommst du Tipps, die im offiziellen Gespräch niemand erwähnt. Außerdem lernst du so schnell Kollegen und ihre Aufgaben kennen.
Achte auf die Teamdynamik und Arbeitsweisen
Jedes Team hat seine eigene Art zu arbeiten. Beobachte, wie Kollegen miteinander umgehen, wer wofür zuständig ist. Die Abläufe lernst du besser kennen. Je früher du diese verstehst, um so schneller findest du deinen Platz im Team.
Mache dir die erste Woche nicht unnötig schwer! Denk an Verpflegung!
Nichts ist schlimmer als mit knurrenden Magen im Büro zu sitzen und keinen Snack oder für mittags eine Kleinigkeit zu essen zu haben. Du hast genug mit deinem Kopf zu tun, kein Platz für Hungerstress.
Sei freundlich, aber sage nicht zu allem „Ja“ und „Amen“
Freundlich sein zu allen Kollegen ist ein Muss, aber alles machen, ohne nachzudenken ist nicht in Ordnung. Du solltest Aufgaben hinterfragen, wenn du Zweifel hast. Auf eine höfliche Art und Weise versteht sich.
„Könnten Sie mir das bitte noch einmal zeigen?“ hört sich besser an als „Ich habe es nicht gecheckt.“
Wie du etwas sagst oder fragst, macht oft einen Unterschied. Zeige stets, dass du motiviert bist, den Sachverhalt verstehen zu wollen.
Gib nicht auf, auch wenn du am Anfang Startschwierigkeiten hast
Auch wenn du dich fragst, was du in diesem Betrieb überhaupt machst, denke daran, dass Zweifel in der ersten Zeit normal sind. Viele deiner auszubildenden Kollegen sind in den ersten Wochen überfordert. Das legt sich mit der Zeit und du solltest nicht voreilig urteilen. Schaffe dir einen Überblick und bewerte erst nach dem ersten Vierteljahr.





